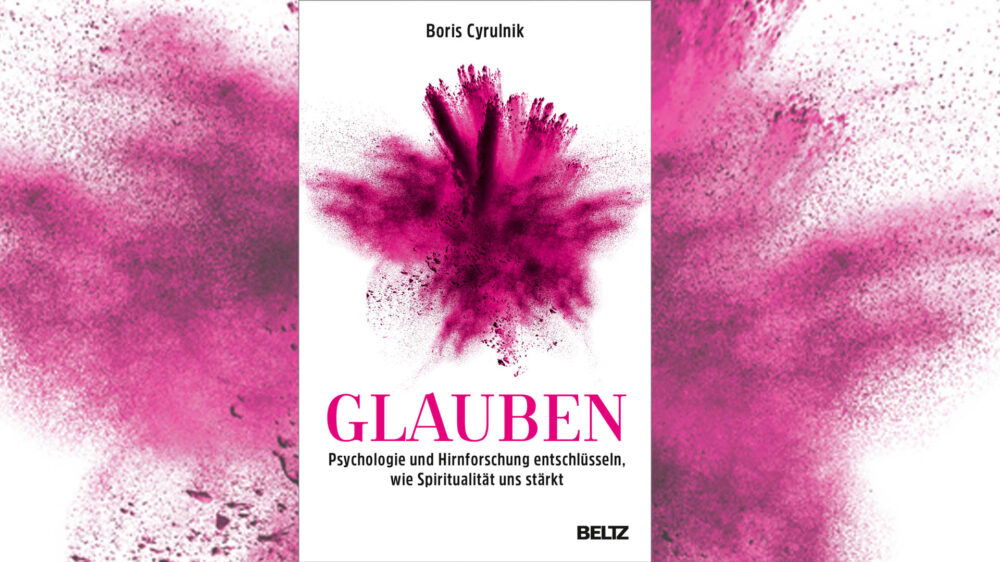Boris Cyrulnik, 1937 in Bordeaux geboren, ist Neurologe und Psychiater. Der jüdisch-stämmige Atheist ist ein Experte für „Resilienz“, also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. In seinem Buch „Rette dich, das Leben ruft“ (2013) zeichnete Cyrulnik 75-jährig seine eigene Lebensgeschichte nach, die selbst von einem Trauma geprägt ist: Seine Eltern, jüdische Einwanderer aus der Ukraine, wurden in Auschwitz ermordet. Er selbst entging nur mit großem Glück dem Konzentrationslager. Als Kind lebte er bis zum Ende des Kriegs bei Fremden in Verstecken.
Der Beltz-Verlag verkauft das neue Buch mit den Worten: „Es ist eine Inspiration für Gläubige und Zweifler, die eigenen spirituellen Ressourcen kennenzulernen und zu stärken.“ Wie sehr mag dieses Versprechen über ein Buch, geschrieben von einem Atheisten, zutreffen, das ein Verlag macht, der weniger für erbauliche Christen-Literatur bekannt ist als vielmehr etwa durch die Kinderbücher von Janosch, einem bekannten deutschen Atheisten?
„Eine überwältigende Mehrheit spürt das Bedürfnis zu glauben“, stellt der Psychiater Cyrulnik fest. Tendenz steigend. Man kann den Glauben also als aufgeklärter Forscher nicht einfach ignorieren. Aber wie erklärt man ihn? Offenbar ist ein gläubiger Mensch hin- und hergerissen zwischen zwei Gegensätzen, so Cyrulnik. Einerseits drängt sich ihm die Frage auf: Wie kann Gott so viel Leid in der Welt zulassen? Gleichzeitig bietet der Glaube an Gott doch so viel Trost!
Dieses Dilemma findet sich für Cyrulnik zusammengefasst in Gestalt eines kongolesischen Jungen, der als Kindersoldat arbeiten musste und der ihm sagte: „Nur in der Kirche fühle ich mich wohl.“ Die Geborgenheit einer Familie, die schützende Umarmung eines Vaters kann ein Mensch in der Erinnerung auch dann abrufen, wenn er in größter Not und verlassen ist, so Cyrulniks Erklärung. Wie praktisch, wenn man dies auf ein immer anwesendes übernatürliches Wesen übertragen kann: Gott. Die Neurologie scheint Cyrulnik Recht zu geben, denn in Augenblicken der Angst könne die Zuneigung zu Gott am stärksten werden. Laut Umfragen fühlten von den Menschen, die das Grauen des Holocausts erleben mussten, 70 Prozent just in dieser Zeit ein übergroßes Bedürfnis nach Gott, nur 16 Prozent verloren angesichts des Grauens nach eigener Aussage ihren Glauben an Gott.
Ein chemischer Cocktail namens Religion
Längst ist bekannt, dass bestimmte chemische Stoffe ähnliche Gefühle der Euphorie hervorrufen können, wie sie Gläubige erleben. Kortison, Amphetamine oder Stoffe aus Pilzen und anderen Pflanzen. Selbst das Gefühl, seinen eigenen Körper zu verlassen, wie es Menschen mit Nahtoderlebnissen beschreiben, sei nicht nur neurologisch gut erforscht, sondern sogar künstlich hervorrufbar, schreibt Cyrulnik. Dann ist es nur folgerichtig, das Gefühl der Ekstase in religiösem Kontext mit Erotik zu vergleichen. Tatsächlich nimmt das Thema Sexualität einen wichtigen Platz in Cyrulniks Buch ein; dem ist sogar ein eigenes Kapitel gewidmet.
Bei der Gelegenheit kommt er auch auf die Reglementierung von Sex in Religionen zu sprechen. Nur weil manche Religionen den Sex in einem geregelten Rahmen sehen möchten, spricht Cyrulnik von einem „Sex-Verbot“. Und das sei ebenso sinnlos wie ein Verbot „zu atmen oder Wasser zu trinken“. Dieses Strohmann-Argument nutzt der Atheist dann für einen Seitenhieb gegen Religion.
Immer wieder stellt der Psychiater Religion und Atheismus gegenüber, wobei der Atheismus meistens deutlich besser wegkommt. Während Gläubige wahrscheinlich gläubig wurden, weil sie „in einem kriegerischen Umfeld oder unter prekären sozialen Bedingungen ein schwieriges Leben“ hatten und nun „einen Abwehrmechanismus“ bräuchten, sind Atheisten meistens „in einer friedlichen Umgebung aufgewachsen“. Die Folge: der linke Frontallappen von Atheisten ist „dominant und eher euphorisch“.
Glückliches atheistisches Dänemark
Cyrulnik ist tatsächlich der Meinung, man könne die Menschen in zwei Gruppen einteilen: Atheisten und Gläubige. Die immer mutiger werdenden Stereotypen sollen dem Leser wohl unterschwellig vermitteln: Soll man Gläubige doch an Gott glauben lassen, offenbar nützt es ihrem Gehirn; ein Atheist aber hat das glücklicherweise nicht nötig. In Dänemark zum Beispiel sind alle glücklich. Man könne da sogar sein Fahrrad unverschlossen an eine Mauer lehnen, und es werde nicht geklaut, ist Cyrulnik begeistert. Der Grund liegt aber nicht etwa darin, dass es dort so viele Fahrräder gibt, sondern, genau: Dort sind die meisten Menschen eben Atheisten.
Andererseits fällt das theologische Wissen beim Neurologen eher flach aus. Es findet im Buch weitestgehend nur in Form des Katholizismus statt. Vom protestantischen Erlösungsglauben und eventuell einer Befreiung von Schuldgefühlen und deren positiven Auswirkungen beim Psychiater und Resilienzforscher Cyrulnik kein Wort. Stattdessen stellt er die Verehrung Marias mit der Anbetung der „Urmutter der Weltschöpfung“ bei den Aborigines gleich. Religion ist bei ihm lediglich Gesetzeswerk, an das sich zu halten bei manchen Menschen ein gewisses Bedürfnis befriedigt.
Pfaffenfresser
Immer wieder nimmt der Mediziner die herzzerreißende Liebeseschichte von Heloise und dem Pater Abaelard aus dem 11. Jahrhundert als Erklärung dafür, wie Christen es auch heutzutage offenbar mit der Sexualität halten. Die Verallgemeinerungen treiben weitere seltsame Blüten: „Gläubige halten es oft für unmoralisch, Geld zu besitzen, während Atheisten es eher unmoralisch finden, Geld einzunehmen, ohne es verdient zu haben.“ Und: „Religiöse Menschen sind sehr auf Gewissheiten und Traditionen bedacht. Für sie bedeutet jede Veränderung ein Angriff, während sie für einen Nichtgläubigen ein stressiges, aber vergnügliches Abenteuer ist, das ihm das Gefühl gibt, lebendig zu sein.“ Wir lernen: Religiöse Menschen nerven, Atheisten sind entspannte Zeitgenossen. Einmal nutzt der deutsche Übersetzer aus unerfindlichen Gründen das Wort „Pfaffenfresser“ im Zusammenhang mit Atheisten. Und es steht dort nicht in Anführungszeichen.
Das Buch „Glauben. Psychologie und Hirnforschung entschlüsseln, wie Spiritualität uns stärkt“ malt ein Bild von Religionen, die helfen können, wenn man auf ihre neurologischen Vorteile abzielt. Nur: Wer glaubt an etwas Übernatürliches nur aus dem Grund, dass ihm dies in seinem Gehirn eventuell einen Vorteil bringt? Und natürlich schafft Glaube Identität und Gemeinschaft, aber ist das der Grund, an die Existenz eines Gottes zu glauben? So bekommt der Glaube an Gott bei Cyrulnik eine ähnliche Funktion, wie wenn ein Erwachsener der lästigen Frage eines Kindes nach der Herkunft von Babys ausweicht mit der Antwort: Vom Klapperstorch. Praktisch, aber falsch.
Boris Cyrulnik: „Glauben. Psychologie und Hirnforschung entschlüsseln, wie Spiritualität uns stärkt“, Beltz, 288 Seiten, 22,95 Euro, ISBN 9783407865373
Von: Jörn Schumacher