pro: Sie haben öfter kritisiert, dass die Grundrechte im Kampf gegen Corona eingeschränkt wurden. Und unsere Politiker argumentieren, dass das notwendig war, um der Pandemie Herr zu werden. Hätte es denn Alternativen gegeben?
Heribert Prantl: Grundrechte heißen so, weil sie auch in Zeiten der Not und der Katastrophe gelten. Wir erleben die größten, heftigsten, tiefgreifendsten Grundrechtseinschränkungen seit Beginn der Bundesrepublik. Die Maßnahmen gegen Corona überschreiten auch das, was nach den Regeln der Notstandsgesetze möglich wäre. Das Parlament ist weit weniger eingeschaltet als vorgesehen.
Natürlich gibt es die Möglichkeit, Grundrechte einzuschränken, solange das nicht ihren Wesenskern berührt. Genau das ist aber bei einigen Maßnahmen der Fall: wenn Geschäfte, Restaurants, Kultureinrichtungen geschlossen werden, wenn Hunderttausenden von Menschen damit die Existenzgrundlage wegbricht. Die generellen, pauschalierenden Eingriffe in die Grundrechte durch Verbote, Ausgangssperren, Schul- und Betriebsschließungen sind heikel. Sie werden nicht weniger heikel dadurch, dass man sich den Zutritt zu den verschlossenen Grundrechten – aktuell durch eine Impfung – wieder erwerben kann.
Es ist zu wenig danach gefragt worden, wie geeignet, verhältnismäßig und erforderlich diese Eingriffe waren und sind. Mir geht es darum: Wenn Grundrechte eingeschränkt werden, dann bitte weniger generalisierend, sondern weit differenzierter, als es bislang geschieht.
Mitte Januar hat das Amtsgericht Weimar einen Mann freigesprochen, der gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen hatte. Das Gericht argumentierte damit, dass der Lockdown nicht verhältnismäßig und nicht verfassungskonform gewesen sei. Wie schätzen Sie das Urteil ein?
Es war ein Urteil der unteren, der ersten Instanz. Das wird sicherlich in Kürze in der nächsten Instanz, vom Landgericht, geprüft werden. Es ist gut, richtig und wichtig, wenn die Justiz die Maßnahmen gründlich prüft und so ihrer Rolle als dritter Gewalt gerecht wird. Es wäre gut, wenn nicht nur ein Urteil eines Amtsgerichts, sondern sehr bald ein fundamentales Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorläge. In den fünfziger Jahren war es so, dass das Bundesverfassungsgericht zu schwierigen Rechtsfragen noch Gutachten erstattete. Das wurde abgeschafft. Aber seit Beginn der Pandemie habe ich mir herzlich gewünscht, dass es die Möglichkeit noch gäbe: Gutachten vom höchsten Gericht zu den Grundrechtseinschränkungen in der Pandemie. Dann hätte man schnell klare Maßgaben gehabt.
Sie haben einmal gesagt, dass in der Corona-Krise mit Angst Politik gemacht wird. So ähnlich heißt auch der Titel eines Ihrer Bücher. Darin geht es aber um Terrorismus. Welche Parallelen sehen Sie?
Natürlich gibt es gemeinsame Muster. Mir ist das schon bewusst geworden, als man zu Beginn der Pandemie zeitlich befristete Gesetze erlassen hat. Die Erfahrung aus der RAF-Zeit, aus der Zeit des Linksterrorismus bis hin zum islamischen Terrorismus ist, dass aus Ausnahmegesetzen Dauergesetze werden: Erst werden sie immer weiter verlängert – das erleben wir jetzt schon bei der Pandemie – und dann wird aus dem verlängerten Ausnahmegesetz ein Standard, also der Normalfall. Der Unterschied zur Pandemie ist der: Die Terrorismusgesetzgebung war relativ weit weg von den Menschen, Terrorismus spürten wir nicht so hautnah wie die Gesundheitsgefährdung durch das Virus. Deswegen ist die Versuchung groß, jetzt alles Erdenkliche zu akzeptieren, um selbst geschützt zu sein.
Die Gefahr durch das Virus ist real und betrifft die Breite der Bevölkerung.
Richtig. Aber: Die Art und Weise, wie Politik in den vergangenen Monaten agiert hat, hat die Sicherheit nicht gesteigert, sondern die Unsicherheit verstärkt. Ich werfe der Politik, den Virologen und Epidemiologen vor, dass sie bei aller Realität der großen Virus-Gefahr den Menschen zu wenig Hoffnung geben. Wenn die erste Welle rollt, wird von der zweiten Welle gesprochen; es gibt immer neue Fristen, bis zu denen wir durchhalten sollen, der Gefahr folgt das angeblich noch Gefährlichere. Wenn die Menschen die Hoffnung verlieren, schwindet die Akzeptanz für die Maßnahmen. Dann wird es richtig gefährlich. Hinzu kommt, dass die Politiker monatelang damit Hoffnungen gemacht haben, dass mit der Impfung alles besser wird. Und dann beginnt die Impferei mit einem logistischen Desaster. Der Mangel an Impfstoff ist ein zentraler Skandal – und das Organisationsversagen der Regierung ist ein Fall für einen Untersuchungsausschuss.
„Die große Gefahr dieser Krise liegt darin, dass das Bewusstsein entsteht, man müsse Grundrechte opfern, um des Problems Herr zu werden.“
Fürchten Sie, dass unsere Demokratie und die Grundrechte infolge der Pandemie längerfristig Schaden nehmen?
Ja, ich befürchte, dass die Reaktionen auf die Pandemie, die wir jetzt seit fast einem Jahr erleben, zur Blaupause werden für alle möglichen folgenden Katastrophen. Es kann ja gut sein, dass diese Pandemie nicht die letzte ist, dass es weitere Seuchen geben wird, dass man womöglich auf andere Katastrophen, die Klimakatastrophe beispielsweise, mit ähnlichen massiven Grundrechtseinschränkungen reagiert.
Lässt sich das überhaupt noch aufhalten?
Das hoffe ich sehr. Dafür sind Journalisten da. Die Pressefreiheit ist dafür da, die Freiheit zu verteidigen. Natürlich weiß ich, wie gefährlich das Virus ist und dass es Gesundheitsvorkehrungen auch ungewöhnlicher Art braucht. Aber ich werbe dafür, dabei die Grundrechte zu achten und deutlich zu machen, dass sie nicht nur für sonnige Zeiten da sind. Einschränkungen können gut sein, sind aber nicht per se gut. Die große Gefahr dieser Krise liegt in meinen Augen darin, dass das Bewusstsein entsteht, man müsse Grundrechte opfern, um des Problems Herr zu werden. Dabei sind sie die Leuchttürme, die in Zeiten der Krise besonders intensiv leuchten.
Die Rolle der Journalisten in der Pandemie haben Medienwissenschaftler kritisch bewertet: zu behördennah, zu wenig tiefe Recherche, thematisch zu eng. Was ist Ihr Eindruck?
Als Frühwarnsystem haben die journalistischen Medien gut funktioniert. Derzeit agieren sie in der Rolle des Dauerwarnsystems. Wenn es dazu kommt, dass sich in Spitzenzeiten 70 Prozent aller journalistischen Inhalte mit Corona beschäftigen und alle anderen Themen aufgefressen werden, ist das ein Problem. Das zeichnet ein schiefes Bild von der Realität. Natürlich ist Corona sehr gefährlich. Aber es gibt eine Vielzahl weiterer Themen, die der Behandlung bedürfen. Die Kollateralschäden der Anti-Corona-Maßnahmen wurden und werden viel zu wenig beachtet, auch die Auswirkungen der Maßnahmen auf die dritte und vierte Welt sind aus dem Blickfeld verschwunden.
Was müsste unsere Zunft besser machen?
Zuerst einmal muss man sich klar machen, dass es andere Themen außer Corona gibt. Und die Berichterstattung muss der Bandbreite wissenschaftlicher Meinungen gerecht werden, es braucht breite Diskussionen über die politischen Entscheidungen. Wir dürfen nicht den Satz nachbeten, den die Kanzlerin gern sagt: Die Maßnahmen seien alternativlos. Immer wenn Politiker das sagen, müssten bei Journalisten die Warnlampen aufblinken. Immerhin: In den vergangenen Wochen ist in den Medien auch mehr und mehr darüber diskutiert worden. Auch die Kirchen sind dabei gefragt.
Für die Kirchen haben Sie in der Pandemie schon sehr kritische Worte gefunden.
Mein Vorwurf an die Kirchen ist, dass sie sich kleingemacht haben. Sie haben nicht dagegen protestiert, dass die Sterbenskranken in den Kliniken im Frühjahr vergangenen Jahres einsam und allein sterben mussten. Sie haben sich nicht empört, als die Alten in den Pflegeheimen isoliert wurden. Der persönliche Beistand wurde der Pandemie geopfert. Ich glaube nicht, dass Nächstenliebe, die zu leben die Aufgabe der Kirche ist, in der eifrigen Übererfüllung der staatlichen Verordnungen besteht.
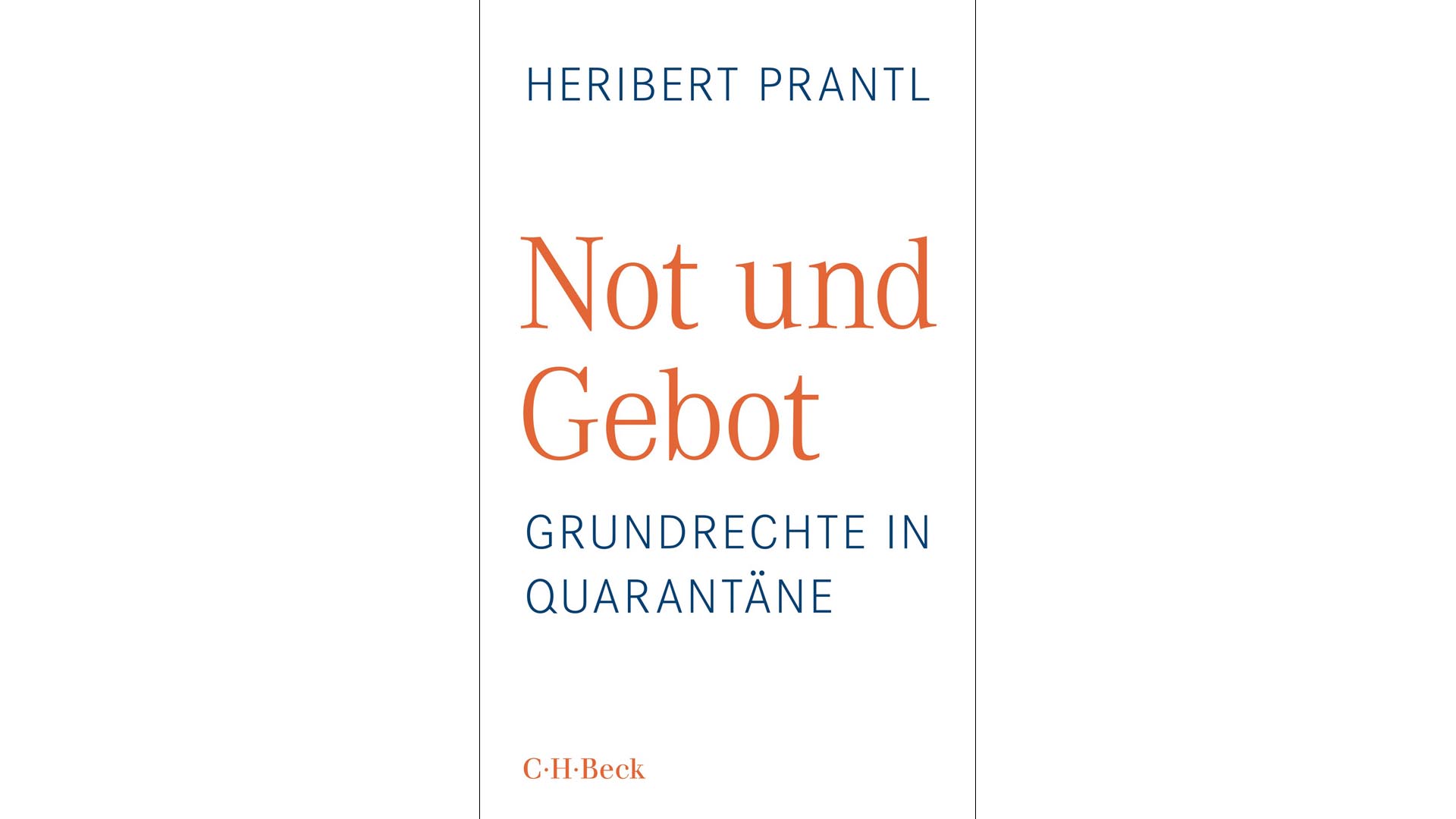
Viele Gemeinden sind aber auch sehr kreativ geworden, um trotz der Einschränkungen geistliches Leben und Gemeinschaft zu ermöglichen.
Das war ganz sicher so! Ich kenne Gemeinden, Pfarrer, Ehrenamtliche, die alles Mögliche getan haben, um die Kirche nicht ausfallen zu lassen, sondern anders als bisher zu gestalten. Seelsorger in den Krankenhäusern und Altenheimen haben gewiss bis zur Erschöpfung gearbeitet. Aber ich bedaure, dass das wenig Strahlkraft nach außen hatte. Die öffentlichen kirchlichen Äußerungen wirkten, wenn auch tönend von Verantwortung und Nächstenliebe, ziemlich kleinmütig und angepasst.
Was hätten Sie sich von den Amtsträgern erwartet?
Ich hätte mir erwartet, dass sich die Kirche durch ihre Amtsträger viel deutlicher äußert. Dass sie dann widerspricht, wenn staatliche Maßnahmen tief in die Religion eingreifen. Und ich hätte mir gewünscht, die Kirchen hätten lauter bekannt, dass die Maßnahmen, selbst wenn man sie für notwendig erachtet, wehtun. Statt den geforderten sozialen Abstand in der Krise zu beklagen, haben die Kirchen ihn zur neuen Form von Liebe umdefiniert. Schuldnerberatung, Suchthilfe, Schwangerschaftskonfliktberatung, Seelsorge geraten am Telefon schnell an ihre Grenzen. Und dann genügt es mir nicht, wenn der Ratsvorsitzende der Protestanten sagt, es sei nicht die Zeit für Aufsässigkeit.
Zumindest dies hätten die Kirchen gekonnt: Laut über die Härten zu klagen, den Betroffenen, die darunter leiden, eine Stimme zu geben – den Eltern zum Beispiel, die nicht mehr wussten, wie sie das Homeschooling organisieren sollen. Es wäre auch Trost, Trostlosigkeit offenzulegen und nicht einfach Pflaster drüber zu kleben. Ich war maßlos enttäuscht darüber, dass man am Anfang der Krise die Gotteshäuser geschlossen hat, dass Gottesdienste und Andachten ausgefallen sind. In der Corona-Krise haben sich die Kirchen der ernüchternden Wirklichkeit zu sehr ergeben. Ich hatte manchmal wirklich den Eindruck, Gott ist im Gotteshaus allein zu Haus.
So, wie Sie Ihre Kritik formulieren, scheint es Sie umzutreiben, wie sich die Kirchen verhalten haben. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Weil ich Christ bin und weil ich mir von meiner Kirche in schwieriger Zeit Beistand für die Gläubigen erwarte. Kirchen sind immer Haltestellen gewesen – Haltestellen zu warten darauf, dass es besser wird. Dass Leid vergeht. Dass Gefahr schwindet. Und dass man dort Vorstellungen von einer besseren Welt entwickelt. Haben die Kirchen – zumal in der ersten Phase der Krise – Visionen entwickelt, Vorstellungen von einer besseren Welt? Es wäre ihre Aufgabe gewesen. Wo blieb die Hoffnung, die Erquickung, die die Kirchen gegeben haben? Wo war wenigstens ihr Widerstand gegen die Hoffnungslosigkeit?
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ – das gilt erst recht in unnormalen Zeiten. Der Mensch lebt von Gottes Wort, sagt Jesus, von Wort und Berührung. Die Frau im Altersheim lebt vom Besuch des Sohnes. Der Mann im Krankenhaus mit der Krebsdiagnose lebt vom tröstenden Gespräch. Die trauernde Tochter lebt vom Hören der letzten Atemzüge der Mutter. Da frage ich mich: Haben die Kirchen diese Wahrheit ernst genommen, als beim Lockdown ohne Wimpernzucken die persönliche Begegnung verboten wurde?
Was an der Bibel und am christlichen Glauben ist für Sie persönlich erquicklich?
Erquicken heißt Trost geben, Halt geben, Angst nehmen, kräftigen, stärken. Das gilt für die Coronazeit genau so wie für die Zeiten persönlicher Krisen. Das kann auch bedeuten, dass ich in die Kirche gehe und ein Licht anstecke. Oder, wenn keine Gottesdienste stattfinden, dass ich mich in die Kirchenbank setze, der Orgel zuhöre und eine halbe Stunde meditiere. Das erwarte ich von den Kirchen und nicht, dass draußen ein Schild hängt „Wegen Corona geschlossen“.
„Ich hatte den Eindruck, Gott ist im Gotteshaus allein zu Haus.“
In normalen Jahren singt die Innenpolitik-Redaktion der Süddeutschen Zeitung vor Weihnachten gemeinsam Weihnachtslieder. Wie läuft das ab?
So ist es Tradition: Diese Redaktion setzt sich am letzten Arbeitstag nach der Produktion der Zeitung hin und singt zur Einstimmung auf die Feiertage Weihnachtslieder, ganz viele, auch ziemlich unbekannte. Es gibt dafür ein eigenes „Weihnachtsliederbuch der innenpolitischen Redaktion“; 46 Lieder sind dort versammelt. In meinen ersten Jahren bei der SZ, vor über dreißig Jahren, war das „Weihnachtsliedersingen“ eine kleine Veranstaltung, da saßen ein Dutzend Redakteure um den Tisch des Ressortleiters, später, als Ressortchef, habe ich dann auch deren Kinder hinzu gebeten, die hatten ihre Musikinstrumente dabei und spielten bei den bekannten Weihnachtsliedern mit. Die eher unbekannten haben sie dort gelernt. Der wunderbare Kollege Hermann Unterstöger, der große Streiflicht-Schreiber, hat mir dazu gesagt: „Das Weihnachtssingen war und ist für uns – zumindest für die Älteren unter uns – weit mehr als ein besinnliches Gaudium. Es gab den Zeitläuften eine Struktur und unserer kleinen Gemeinschaft eine Ahnung vom Sinn der Dinge.“ Im Corona-Jahr ist es erstmals ausgefallen.
Manchmal haben wir drei, vier Stunden lang gesungen, unterbrochen von einem „Würstl-Essen“. Das Erstaunen ist oft groß, wenn ich von diesem Brauch des Weihnachtssingens in einer Redaktion, die als linksliberal gilt, erzähle. Aber es zeigt, dass das Bedürfnis nach Besinnung da ist und dass es auch Menschen Freude schenkt, die mit Religion und christlichem Glauben nicht so viel am Hut haben.
Haben Sie ein Lieblings-Kirchenlied auch über das Weihnachts-Repertoire hinaus?
Da ist erst einmal „Maria durch den Dornwald ging“; dann mag ich die Lieder der Deutschen Messe von Franz Schubert, die sind mir vertraut und sehr nahe: „Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken?“ Und wenn ich mich festlich fühle wie an den Weihnachtstagen, stehe ich gern früh auf, zünde die Kerzen am Weihnachtsbaum an und höre das „Gloria“ von Vivaldi. Das ist herzliche Festlichkeit.
Sie sagten, dass Sie in der Kirche gern die Orgel hören?
Ja, sehr gerne. Sie gehört für mich in die Kirche. Ich hab sie nicht so gern in Konzertsälen. Eine Orgel hat eine unglaubliche Ausdrucksweise von Stimmungen – vom Klagen bis hin zum festlichen Brausen. Dazu gibt‘s eine Geschichte aus meiner Zeit als Redaktionsleiter.
Erzählen Sie!
Ich habe einmal im Jahr meine Redakteure und Korrespondentinnen zu einer Klausurtagung eingeladen, drei Tage lang auf der Insel Frauenchiemsee, im Kloster. Da haben wir politische und redaktionelle Fragen besprochen. Diese Klausurtagung hat immer mit einem kleinen Orgelkonzert in der uralten Kirche von Frauenchiemsee begonnen. Wenn dann Kollegen von außerhalb Bayerns kamen, haben sie das immer als Initiation in die bayerische Tradition empfunden. Gar nicht als etwas Fremdes, sondern als was ganz Eigenes und Wohltuendes.
Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Jonathan Steinert


