Gott und Toast“ steht da in einem der ersten Gedichte des Bandes, „Gott und Toast und Butter und ein Manufactumkatalog“, als sei Gott ein profaner Bestandteil des Lebens wie die Dinge, die eben so manchmal auf dem Frühstückstisch liegen. Nora Gomringer schreibt in „Gottesanbieterin“ sowohl sehr persönlich als auch kritisch über ihre eigene Religiosität. Auf einer beiliegenden CD spricht die Autorin ihre Texte selbst. Sie thematisiert Abtreibung und zitiert ganz nebenbei den großen christlichen Dichter Matthias Claudius: „Ich danke Gott und freue mich, wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin und dass ich dich, schön menschlich Antlitz habe.“
Religiös wird es vor allem im letzten Teil des Buches, der die Überschrift „Angebot“ trägt. Die Lyrikerin nimmt manchmal ihre eigene Kirche aufs Korn, oder betrachtet sie zumindest skeptisch. Im Gedicht „Man sieht’s“ heißt es: „Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden von Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz.“ Dann klingt es woanders wieder so, als fühle sie sich letztlich bei Gott gut aufgehoben, wie im Gebet „Herr“.
„Ich hoffe, Jesus besser kennenzulernen.“
Im längsten Text des Bandes, „Vor Arvo Pärts Stabat Mater zu rezitieren“, geht es zunächst um die Auferstehung Jesu: „Und der Stein wurde zur Seite gerollt und sie fanden das Grab leer Jesus ist wie Schrödingers Katze“. Das leere Grab ist da „eine Beleidigung und ein Wunder“, und Gomringer fragt kritisch: „Ist er aus seinem Büro gegangen, ohne seine Affären geordnet zu haben?“ Am Ende ist dann vor allem Erleichterung: „Aller Schmerz ist fort. Gibt Erkennen und Freude. Gibt unbändige Freude.“ Immer wieder stellt sie sich vor, wie es wäre, wenn Jesus heute auf die Erde käme, wie etwa im Gedicht „Kämst du heute“: „Komme auch auf YouTube und live! Unbedingt live! 12 Follower? Daran muss man arbeiten.“ In „Jesus kommt“ stellt sie dar, wie sich die Menschen wohl verhalten würden, stünde Jesus plötzlich vor der Tür: „Wir räumen auf, kehren unter den Teppich, stellen uns gerade hin mit geschnittenen Haaren, ziehen ein Kleid an, auch die ehrlichen Jungs, sagen artig Danke und Bitte. Jesus, der schaut. So kennt der uns gar nicht. Fragt, ob er sich in der Tür geirrt.“ Ganz am Ende des Buches bekennt Gomringer: „Ich bin die Christin, die an zu viel Weihrauch, nicht an zu wenig sterben möchte. Ich bin die Christin, die die weißen Westen der Diener Gottes anschwärzt.“
Bibel ist unverzichtbar
Sie wolle in „Gottesanbieterin“ schon ein wenig Gott anbieten, jedenfalls „eine Form von Glauben-Leben“, sagt die katholisch erzogene Gomringer gegenüber pro. Dabei scheint sich auf dem Cover des Bandes in das titelgebende Wort irgendwie ein „f“ eingeschlichen zu haben, so könnte der Titel fast auch als „Gottesfan“ gelesen werden. War das Absicht? „Absicht der Designerin ist es wohl“, sagt Gomringer im Interview. „‚Fan‘ klingt immer etwas überanstrengt. Ich bin gerne gläubig. Ich denke, das reicht Gott.“ Christsein bedeutet für sie: „Die Sakramente empfangen zu haben, die mein Leben bisher begleiten als Wegzeichen und Segen. Und es bedeutet für mich – und das mag den Hardlinern komisch erscheinen – Flexibilität, intellektuelle Freude und Güte.“
Jesus selbst sei ihr irgendwie fremd geblieben, bekennt sie. „Ich bin neugierig auf ihn und hoffe, ihn in der jetzt beginnenden zweiten Hälfte meines Lebens besser kennenzulernen“, sagt die 40-Jährige. Mit der Bibel habe sie sich mit lautem Vorlesen daraus eine Sprechhemmung abtrainiert, und heute sei dieses Buch schlicht „unverzichtbar“. Gomringer fügt hinzu: „Wunder sind mein Faszinosum und Noahs Geschichte ist meine go-to-story, wenn ich Hoffnung brauche.“

Ihren Glauben habe sie ihrer Mutter zu verdanken, sagt Gomringer. Dabei sei dieser „sehr dynamisch“: „Es ist der ‚white noise‘ in meinem Leben.“ Ihr Buch widmet sie „Tim“, und erklärt: „Tim war mein Freund. Wir haben uns über Tinder kennengelernt und eine Freundschaft mit Innigkeit, guten Gesprächen, geteilten Verzweiflungen geformt. Zwei Jahre hatten wir. Tim konnte man immer anschreiben oder anrufen. Er lebte als Frührentner in einer kleinen Wohnung und eine seiner ersten Nachrichten an mich besagte, dass er eine schwere Krankheit hätte und nicht lang leben würde. Warum glaubt man das eigentlich nie, wenn es einem gesagt wird?“, sagt Gomringer gegenüber pro.
Gomringers Vater Eugen geriet vor zwei Jahren verstärkt in die Schlagzeilen, weil sein Gedicht „avenidas“ an der Hauswand der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin stand und für „Kritiker*innen“ als sexistisch galt. Von Blumen ist da die Rede und von Frauen und einem Bewunderer. Das, so fanden einige Studenten, bediene klassische Klischees von Männern, die auf Frauen starren. Für Nora Gomringer stellt dieser Bewunderer schon von Kindheit an aber Gott dar, der seine Schöpfung betrachtet. „Ich war überrascht, als mein Vater sagte, dass das Gedicht völlig ohne religiösen Bezug für ihn ist“, sagt sie, die ihren Vater in einem Interview einmal als „verkappten Christen“ bezeichnete – was er sofort vehement von sich wies.
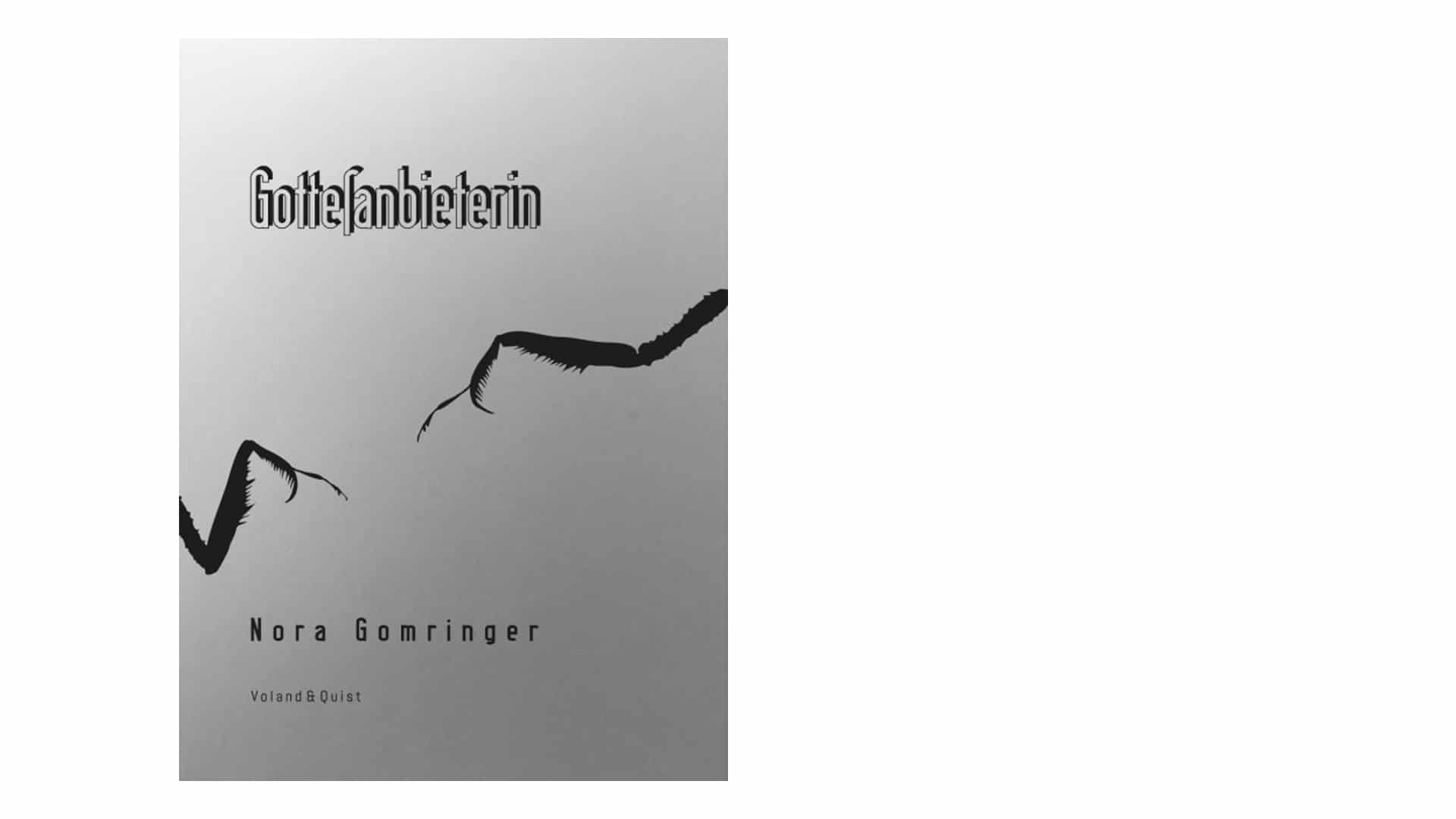
Im Moment sei auch sie, wie viele Künstler, von der Corona-bedingten erzwungenen Ruhe geplagt – finde in ihr aber auch Glück. „Auftreten ist ein großer Teil der Arbeit, aber eben nur einer. Ich trauere um die Auftritte, die abgesagt wurden, aber ich feiere auch die Ruhe, nicht an jedem dritten Tag den Koffer zu packen und viele hundert Kilometer Zug fahren zu müssen.“ Auch der Kirchenbesuch fällt im Moment aus, sagt Gomringer. „Vor Corona bin ich regelmäßig gegangen. Immer mittwochs.“
Dieser Text erschien zuerst in der Ausgabe 6/2020 des Christlichen Medienmagazins pro. Sie können die Ausgabe hier bestellen.


