„Ilja Richter zeigt sich als Gottsuchender, fernab aller Disco-Klischees“, verspricht der Verlag für das Buch des Fernsehstars. Richter sprach schon als Kind in vielen Hörspielen, mit 16 Jahren wurde er 1969 im ZDF Deutschlands jüngster TV-Moderator, bekannt wurde er als Gastgeber der Musiksendung „Disco“, die er von 1970 bis zum Ende der Show 1982 moderierte. Danach arbeitete Richter vorwiegend als Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher, er sprach etwa Mike Glotzkowski im Pixar-Film „Die Monster AG“.
„Ilja Richter nimmt uns mit auf (s)eine Suche nach religiöser Heimat und Zugehörigkeit zwischen Judentum und Christentum“, verspricht der Verlag für das Buch „Lieber Gott als nochmal Jesus“, sowie „einen ungewöhnlichen Blick in die Welt des Glaubens“. Richters Vater war Atheist und Kommunist, der neuneinhalb Jahre im KZ verbringen musste; seine jüdische Mutter überlebte mit gefälschter „arischer Identität“ die NS-Zeit.
Richter selbst ist hin- und hergerissen zwischen Jude-, Christ- und Atheist-sein. Diese Suche, die vor allem in einem Wust aus Erinnerungen, Textstellen, fremden Gedichten, Anekdoten und religiösen Witzen besteht, ist auf erstaunliche Weise leider zunächst etwas anstrengend. Es geht um Religion. Aber so gut wie nie um einen persönlichen Glauben. Hier will jemand nicht glauben, aber gerne religiös sein, sich für keine Konfession entscheiden müssen. Das geht aber nicht, auch nicht für den Atheismus.
Der „5-Minuten-Jude“
Er lebe das Judentum nicht, betonte Richter in einem Interview mit dem Radiosender WDR 3 anlässlich des Buch-Starts. Sein Vater war Atheist, seine Mutter Jüdin, er selbst lebe genau zwischen Kreuz und Davidstern. Wie es sich in der christlich-jüdischen Tradition lebt, wird er gefragt, und er antwortet: „Am besten auf dem Bindestrich.“ Man fragt sich beim Lesen des Buches, ob ihm die Situation eigentlich gefällt, oder ob er daraus ausbrechen möchte? Anders als das Judentum ist das Christentum nicht verbunden mit einer Abstammung, sondern mit einer Entscheidung. Die Möglichkeit, sich für eine von beiden Seiten zu entscheiden, stünde Richter also offen.
Stattdessen scheint es ihm „auf dem Bindestrich“, genau zwischen Kreuz und Davidstern, ganz gut zu gefallen. Dass nach jüdischer Tradition der Sohn einer jüdischen Mutter automatisch selbst Jude sein soll – da will Richter aber auch nicht mitgehen. Würde er aber wiederum Christ werden, würde ihn das gegenüber dem Judentum zu einem „Abtrünnigen“ machen. Schade, dass Glaube nicht etwas unverbindlicher sein kann! Vielleicht meint die Bibelstelle ja genau dies mit dem Ekel vor dem Lauwarmen, wenn jemand weder kalt noch warm ist.
Das Buch, das diesen Zwiespalt in Richters religiösem Empfinden widerspiegelt, liest sich entsprechend genauso widersprüchlich. Die Religion ist bei Ilja Richter vor allem eines: verwirrend. Und so ist es auch das Buch. An einer Stelle nennt sich Richter ironisch einen „5-Minuten-Juden“. Judentum als „5-Minuten-Terrine“: Wenn es gerade passt, gerne, ansonsten: Nein, Danke?
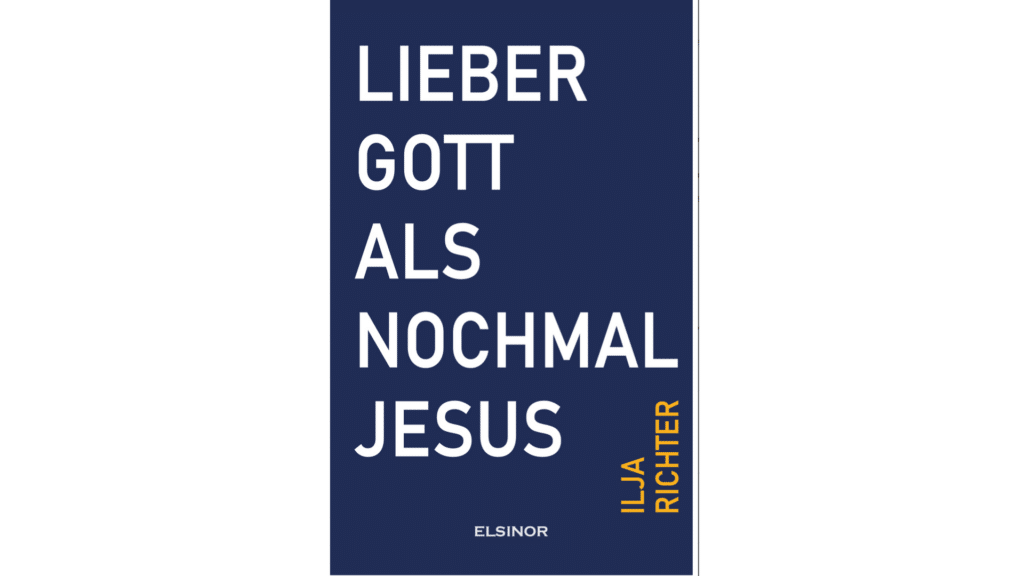
Für gläubige Christen muss die Aussage, man wolle ja eigentlich glauben, tue es aber nicht, und das sei schade, seltsam wirken. „Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn“, diesen Satz eines britischen Schriftstellers stellt Richter dem Buch voran. Aber wenn man jemanden vermisst, warum sucht man ihn nicht mal wieder (auf)? Im Titel des Buches verspricht der Autor, „fast“ eine Beichte ablegen zu wollen. Eine Beichte nur „fast“ abzulegen ist doch keine Beichte? Und was genau würde eigentlich gebeichtet werden?
Die „literarische Form“, die Richter propagiert, besteht unter anderem darin, eine Familiengeschichte zu erzählen, die sich jedoch danach als nicht die seine herausstellt. „Ich habe eine jüdische Verwandtschaft erfunden, weil ich keine jüdische Verwandtschaft habe, schlicht, weil sie umgebracht wurde“, erklärte Richter dem Reporter des WDR. Dem Leser wird viel abverlangt: Was ist nun real, was erfunden? Der Verleger selbst tritt im Buch in Dialogen mit dem Autor auf, und auch der ist abwechselnd enttäuscht oder verwirrt.
Überall Atheisten, die in den Himmel wollen
Man muss sich durcharbeiten zu Kapiteln, in denen es dann doch offensichtlich um Biografisches aus dem Leben des sehr sympathischen Schauspielers geht. Und das ist dann tatsächlich sehr lesenswert – und authentisch. Wie etwa die Situation, als er auf einem Ausflugsdampfer auf dem Wannsee unterwegs ist und der Kapitän an die Touristen durchgibt, dort drüben befinde sich das Haus der Wannseekonferenz, wo „das Judenproblem besprochen worden ist“, als sei nichts selbstverständlicher als dieses „Problem“, um das sich mal jemand kümmern musste. Oder das Kapitel darüber, dass Richter für eine Fernsehrolle das Kaddish lernen sollte, und es einfach nicht über sich brachte. Erst als er vom Tod eines engen Freundes hörte, ging ihm das Totengebet fließend über die Lippen.
Dazwischen ist das Buch eine Sammlung von Texten fremder Autoren, darunter viel Kryptisches; wenn es um Biblisches geht, nur aus den Apokryphen! Da ist vom Thomasevangelium die Rede, von der „Legende vom Kreuz“, griechischer Mythologie, einer „antiken Erzählung“ von der Mutter des Judas, von der Frau von Pilatus. „Das Evangelium nach Pilatus“, einen französischen Roman, zitiert Richter und schreibt dazu: „Eric-Emmanuel Schmitt hat zwei Evangelien geschrieben“, und meint das vielleicht gar nicht so sehr im Spaß? „Evangelium“ ist irgendwie alles, wo es um Gott geht. Zwischen André Kaminski, Michel Bergmann, Wim Wenders und Friedrich Nietzsche sind es dann ausgerechnet immer die Atheisten, die in den Himmel kommen oder zumindest wollen. Interessant auch, dass Richter zwar eine große Anzahl an Romanen, Gedichten, Sagen und Legenden zu biblischen Themen parat hat, aber so gut wie nie eine tatsächliche Stelle aus dem Alten oder dem Neuen Testament, die ihm ernsthaft etwas bedeuten würde. Dieser jüdisch-christliche Glaube ist hier leider viel zu oft reduziert auf kurze Witzgeschichten.
Zwischen Kreuz und Davidstern, oder eigentlich daneben?
Dabei wird die Sehnsucht Richters nach einem religiösen Zuhause überdeutlich. Er möchte gerne in einer katholischen Kirche eine Beichte ablegen, schreckt dann aber davor zurück. Irgendwie scheint es da aber ohnehin nicht um das Bekennen von Sünden zu gehen, sondern um den Wunsch nach einer Aussprache mit Gott. Für ein Gebet braucht man aber doch keine Religion, um zu beten, muss man doch nicht einmal Christ oder Jude sein? Im Kölner Dom zündet Richter eine Kerze für seine verstorbene (jüdische) Mutter an. „Ich trau’ mir ja nicht einmal selbst in meinem Glauben – zwischen Kreuz und Davidstern – über den Weg“, stellt er fest. Hier verwechselt jemand Religion mit persönlichem Glauben. Das eine ist unverbindlich, das andere geht einem nahe.
» Gang durch die christliche Kunstgeschichte
Literarisch ist diese Sammlung teils fremder, teils eigener, teils erfundener, teils biografischer Texte dem Leser gegenüber ebenso unverbindlich wie sie theologisch ein Weder-Noch ist. Das unentschlossene Leben auf dem christlich-jüdischen Bindestrich muss auf Dauer enttäuschend sein. Richter selbst bezeichnet sich an einer Stelle als „religiösen Obdachlosen“, gleichzeitig sagt er von sich: „Aber ich bin ein Glaubender.“ Woran er da glaubt, kann oder mag er dem Leser bis zum Schluss nicht erklären.


