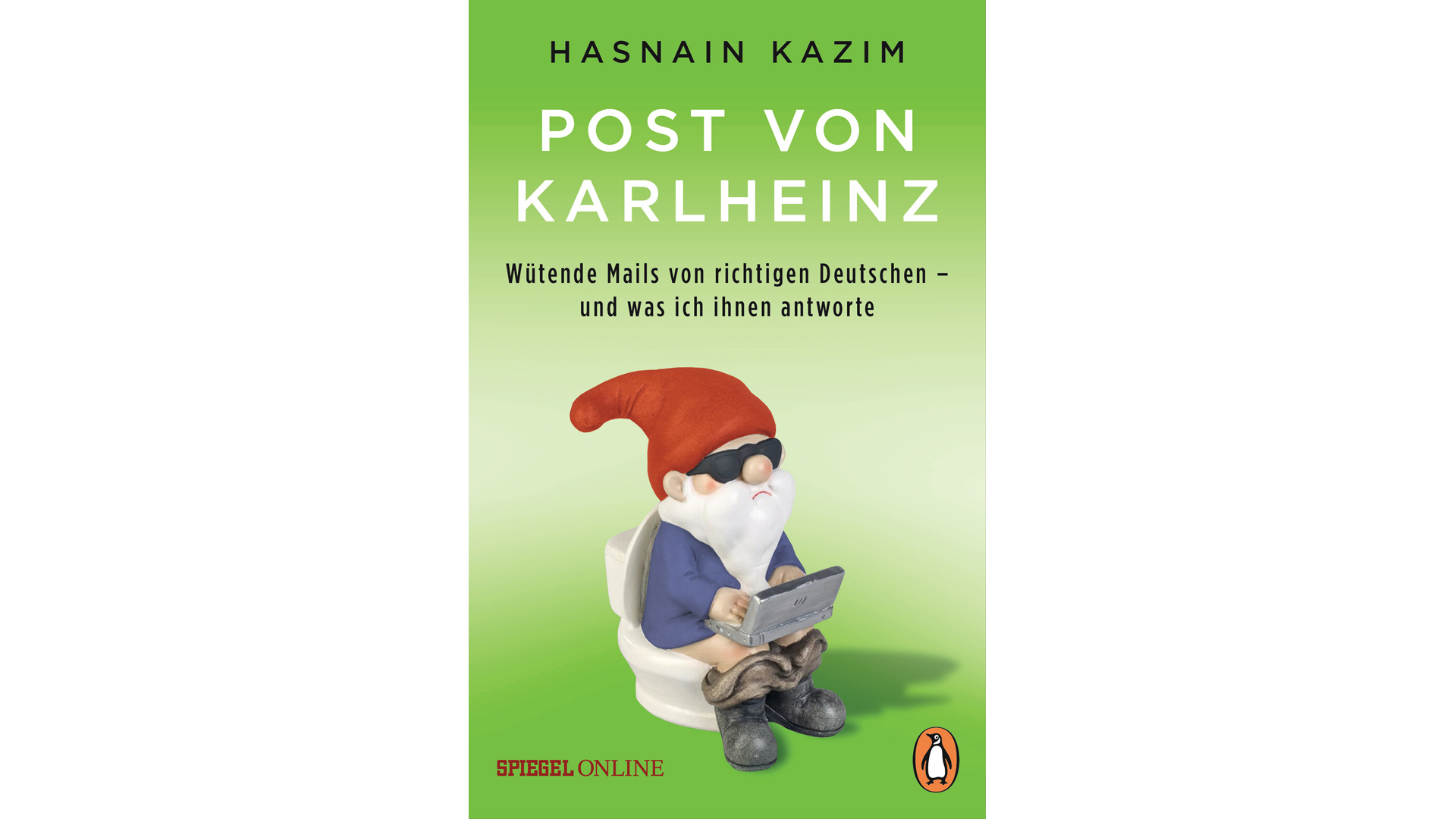pro: Herr Kazim, was hat Sie bewogen, auf so viele Mails zu antworten? Das kostet ja Zeit und Kraft …
Hasnain Kazim: Es kostet sehr viel Kraft und Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass man, wenn man das sehr lange macht, innerlich verbrennt. Mein Hauptgrund war, für mich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Man ist ja, wenn man solche Hassbriefe bekommt, allein damit. Erst recht als Korrespondent, der nicht in einer Redaktion sitzt. Ich kenne Kollegen, die nicht mehr über kontroverse Themen schreiben wollen, weil sie sagen: Ich bekomme da so viel Hass, das halte ich nicht aus. Ich bin eher kämpferisch. Der Dialog nimmt mich aus der Opferrolle heraus, ich kann reagieren. Das ganze Thema ist überhaupt nicht lustig, aber ich wollte etwas Humor reinbringen und das damit auf ein für mich ertragbares Maß schrumpfen.
Haben Sie das Gefühl, etwas zu bewirken?
Ich glaube, zumindest bei einem Teil der Leute führt es dazu, dass sie nachdenken. Viele merken, dass ihre Art nicht in Ordnung ist – und das ist ja schon mal was.
Sie antworten mal höchst ironisch, sogar zynisch, mal argumentierend und offen. Wann wählen Sie welche Antwort?
Selbst wenn ich zynisch antworte – wenn ich merke, da bittet jemand um Entschuldigung oder merkt, er ist viel zu weit gegangen, dann unterhalte ich mich auch mit diesen Leuten. Es sind im Grunde genommen drei Gruppen von Leuten, die einem schreiben. Zum einen die, die ein Ventil suchen. Die kotzen sich sozusagen aus, sind auch manchmal betrunken. Wenn man denen schreibt: „Ist das eigentlich Ihre Art, Kritik zu üben?“, dann kommt oft zurück: „Oh, das tut mir leid, ich wusste gar nicht, dass das jemand liest.“ Die zweite Gruppe hat eine Kritik an durchaus nachvollziehbaren Umständen. Aber was sie schreiben, zum Beispiel „Wir müssen diese Flüchtlinge alle an der Grenze erschießen!!!“, das ist inakzeptabel. Ich komme mir dann vor wie ein Pädagoge, der diese Leute an die Hand nehmen und ihnen beibringen muss, wie man vernünftig Kritik äußert. Die dritte Gruppe, das sind die waschechten Rassisten. Da macht es wenig Sinn. Mit solchen Leuten muss man relativ hart umgehen.
Erleben Sie diese Wut der Menschen auch im direkten Kontakt?
Man merkt, dass der Blick in die Augen etwas anderes bewirkt, dass Menschen da doch eine gewisse Hemmschwelle haben, die ich für richtig halte. Ich komme mir manchmal vor wie ein Opa, aber ich rede viel davon, dass wir wieder Anstand und Moral brauchen. Manches sollte nicht sagbar sein. Ich glaube, es gibt eine große Lücke zwischen virtueller und echter Welt. Leute regen sich auf, wenn ich sie auf meiner Facebook-Seite blockiere, weil sie gegen mich gepöbelt haben. Wenn sie bei mir zu Hause eingeladen wären und würden am Kaffeetisch rumpöbeln, würden sie sich nicht wundern, wenn ich sie rausschmeiße.
Wenn Ihnen in manchen Mails geballter Hass entgegenschlägt – löst das bei Ihnen selbst ein Hassgefühl aus?
Hass nicht, aber Wut. Und ich reagiere mit Sorge, in was für einer Gesellschaft wir leben. Ich stelle fest, dass menschenverachtende Äußerungen immer gesellschaftsfähiger werden. Den Alltagsrassismus habe ich schon immer allein aufgrund meines Namens erlebt. Neu ist die Masse, das liegt am Medium Internet. Früher musste man einen Brief schreiben, ihn frankieren und zum Postkasten bringen, heute geht das mit einem Klick. Was ich aber noch schlimmer finde: Leute schreiben ganz schamlos ihren Namen und sogar ihre Adresse darunter und signalisieren damit, dass sie ihren Hass für eine völlig akzeptable Äußerung halten. Und andere schweigen dazu. Dieses Schweigen macht mir Angst.
Denken Sie, diese Entwicklung geht weiter – oder ist sie vielleicht auch aufzuhalten?
Ich befürchte, sie wird weitergehen, vor allem, wenn wir diese Grenzüberschreitung immer wieder hinnehmen und nichts dagegen tun. Ignorieren führt dazu, dass es immer wiederkommt. Worte müssen Konsequenzen haben, auch juristisch, jeder Mensch trägt für seine Worte Verantwortung.
Auch – zum Teil vermeintliche – Christen melden sich bei Ihnen. Wie erleben Sie den Austausch mit Christen?
Es gibt viele Christen, auch Pastoren oder Diakone, die mir seit dem Erscheinen meines Buches schreiben und mich ermutigen. Sie betonen, dass christliche Nächstenliebe wieder eine größere Rolle spielen und man sehen müsse, wie gut wir es in der westlichen Welt hätten. Bei vielen Christen habe ich aber auch das Gefühl, dass sie das Christsein zur Abgrenzung missbrauchen. Die ganze Geschichte mit dem Kreuz, das in den Behörden in Bayern aufgehängt werden soll, ist ein Beispiel dafür. Auch wenn ich den Hintergrund sogar zum Teil verstehen kann, widerspricht die Art und Weise für mich dem christlichen Gedanken.
Was bedeutet Glaube für Sie persönlich? Fühlen Sie sich in einer Religion zu Hause?
Ich bin kein Atheist. Wenn man sagt, dass man in keine klare Schublade gehört, in meinem Fall: Christ oder Muslim, dann heißt es gleich: Der ist Atheist! Ich bin durchaus ein spiritueller Mensch und kann nachvollziehen, dass Menschen spirituell denken. Manchmal beneide ich auch Leute, die ganz klar einer Religion angehören und nach Regeln der Bibel oder des Koran leben, weil es im Leben vieles einfacher macht. Am ehesten fühle ich mich vielleicht dem protestantischen Christentum verbunden, weil ich im Alten Land in Norddeutschland groß geworden bin. Auf der anderen Seite habe ich schiitische Wurzeln, mit denen ich vertraut bin. Aber zu Hause fühle ich mich eigentlich in keinem. Es gibt bestimmte Dinge, etwa Werte der Aufklärung, die sind mir wichtig und an die glaube ich.
Sie werden von den Mailschreibern in viele Schubladen gesteckt: Muslim, Jude, Islamist, Linker … Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ich selbst bezeichne mich als einen aufgeklärten Menschen, der sich eine liberale, tolerante Gesellschaft wünscht, in der jeder nach seiner Fasson leben und respektieren soll, dass andere anders leben. Allerdings gibt es Regeln, an die sich alle halten müssen. Manches ist mit Recht eingeschränkt, so wie in Deutschland das Leugnen des Holocaust. Das ist natürlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit – aber es hat gute Gründe, dass das so ist.
Die Schreiber werfen Ihnen oft vor, Ereignisse zu sehr zu bewerten. Wie neutral müssen Journalisten berichten – wie neutral können sie überhaupt sein?
Hundertprozentige Neutralität und Objektivität gibt es nicht. Die ist schon bei der Nachrichtenauswahl oder der Wortwahl nicht möglich. Wichtig finde ich, dass man – wenn man nicht gerade reinen Nachrichtenjournalismus macht – eine Haltung zeigt und Dinge einordnet. Oft kommt die Forderung nach kühler Berichterstattung, aber ich finde, wir können über Rassismus nicht kühl berichten, wir müssen das einordnen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Christina Bachmann