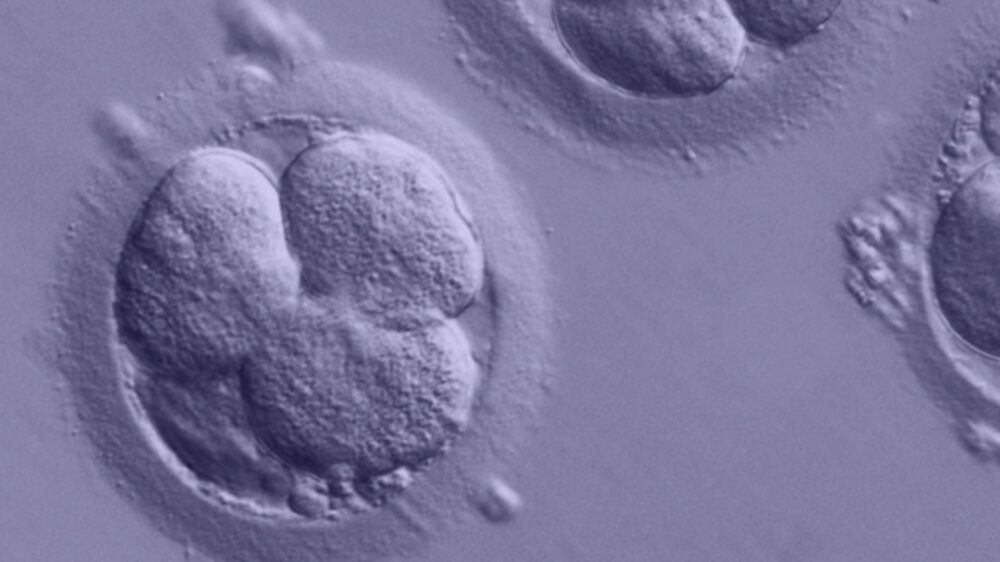„Wie wollen wir in Zukunft mit solchen Möglichkeiten, die uns die Wissenschaft bietet, umgehen?“ Um diese fundamentale Frage gehe es, stellte Josef Hecken (CDU) in Berlin bei einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) klar. Er sitzt dem G-BA vor, dem Gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der B-GA prüft derzeit, ob Bluttests für Schwangere, womit unter anderem eine mögliche Trisomie des Kindes überprüft wird, von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden soll. Diese Bluttests werden seit 2012 im Hinblick auf Risikoschwangerschaften angeboten, müssen momentan aber von den Patientinnen selbst gezahlt werden.
Der Ausschuss selbst hatte eine gesellschaftliche Debatte anlässlich dieser Entscheidung angemahnt. Die EKD reagierte im vorigen November mit einer Stellungnahme ihrer Kammer für Öffentliche Verantwortung. Das Fazit des Kammer-Vorsitzenden, Reiner Anselm: „Es gibt in diesem Feld, wie in manchen Feldern der Medizinethik, keine glatten Lösungen, sondern immer nur Abwägungen, Kompromisse, zweitbeste Möglichkeiten.“ Für Fragen zu vorgeburtlichen Untersuchungen und Diagnosen wünsche sich die Kirche Beratungen, um bei Konflikten weiterzuhelfen – ähnlich wie die Schwangerschaftskonfliktberatung, erklärte der Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. „Wir fordern, dass das Angebot einer ethischen Beratung, die dem Lebensschutz dient, unabhängig und vor der Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik Bestandteil der Schwangerenvorsorge wird.“
 Foto: Christina Bachmann
Foto: Christina BachmannDer Bluttest könnte die riskantere Fruchtwasseruntersuchung ersetzen. Der G-BA beabsichtige, dass der Test zur Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen wird – „aber erst, nachdem die Frau bestimmte Voruntersuchungen im ersten Drittel der Schwangerschaft absolviert hat“, erklärte Hecken. Seine große Sorge sei allerdings die: Es könne dann gesellschaftlicher Druck entstehen, diesen Test zu machen, um eine mögliche Behinderung des Kindes festzustellen. Er verwies auf die Vorwürfe, die den Eltern behinderter Kinder schon jetzt zum Teil gemacht würden, nach dem Motto: Was mutet ihr unserem Sozialstaat damit zu. „Je einfacher diese Dinge werden, umso einfacher wird es, den Eltern das zum Vorwurf zu machen“, so Hecken. Damit bestätigte er Anselms Einschätzung, egal, wie die Entscheidung ausfalle, man könne nur einen Fehler machen.
Mehr Inklusion, bessere Beratung
Die Frage sei nicht, ob man pränatale Untersuchungen zulassen wolle oder nicht, sondern, unter welchen Bedingungen, meinte Ex-Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Sie forderte, bei dieser genetischen Untersuchung müssten die Bedingungen des Gendiagnostikgesetzes gelten. Die Beratung dazu müsse eine hohe Qualität haben. Letztlich sei die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen ausschlaggebend. Auch das Recht auf Nichtwissen sei existenziell, betonte Schmidt. Als Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe wies sie außerdem darauf hin, dass eine Gesellschaft ohne Kinder mit Down-Syndrom ärmer sei. „Die sagen mit Recht: ‚Das ist mein Leben und ich finde mein Leben gut. Warum soll jemand sagen, dass mein Leben nicht wert ist, gelebt zu werden?‘“
„Wir müssen viel deutlicher eine inklusive Gesellschaft werden“, stimmte Pfarrerin Sabine Habighorst zu. „Das ethische Grundproblem, dass wir eine normierende Gesellschaft sind, die Selbstoptimierung und Optimierung des Kindes will, müssen wir als gesamtgesellschaftliches Problem sehen und auch bearbeiten.“ Die Direktorin des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung Berlin betonte, wie wichtig Beratung sei. „Ganz viele Paare denken: Ein Test bringt mir Sicherheit. Aber ein Test bringt vor allem erstmal wahnsinnige Unsicherheit und das ist vielen nicht bewusst.“ Beratung, wie die EKD sie in ihrem Papier beschreibe, gebe es bereits. Sie müsse besser ausgestattet werden, Berater müssten umfassend weitergebildet werden und Medizin und Beratung sich besser vernetzen.
Alle ringen ernsthaft um ein richtiges Ergebnis, diese Erkenntnis resümierte Hecken am Ende des Abends. Dass es in der Runde im Französischen Dom wenig Dissens gab, empfand Anselm nur teilweise als gut. Ihm fehle die Perspektive der Paare, die solch eine Untersuchung wünschten und sich eben nicht vorstellen könnten, ein Kind mit bestimmten genetischen Eigenschaften zu haben. Ihn beschäftige die Frage, wie man diese Menschen erreichen könne, gerade dort sehe er auch die Kirche in der Pflicht. Letztlich, so endet das EKD-Papier, könnten „auch die am weitesten fortgeschrittenen diagnostischen und kurativen Möglichkeiten die Verwundbarkeit des Lebens nicht aus der Welt schaffen. Die Zerbrechlichkeit des Lebens wird erst durch das rettende und vollendende Handeln Gottes überwunden werden.“
Von: Christina Bachmann