PRO: Frau Hartmann, Herr Knieling, Sie haben sich in ihrem neuen Buch mit der Zukunft der Kirche befasst. Wie lange hat die Kirche aus ihrer Sicht noch eine Zukunft?
Hartmann: Also, solange es Gott gibt, wird Kirche sichtbar sein in irgendeiner Form.
Was macht die Kirche für die Menschen attraktiv?
Knieling: Wenn Menschen mit ihren Herzensanliegen und ihrer Sehnsucht vorkommen und sich auf Gott und seine gegenwärtige Wirksamkeit ausrichten können. Wenn Menschen im Gottesdienst oder in Veranstaltungen durch Gott für den Alltag gestärkt werden.
In vielen Gemeinden scheint dieser Ansatz nicht zu funktionieren.
Hartmann: Diese Sicht geht vom Mangel aus. Wir ermutigen dazu, nach den Potenzialen schauen. Manchmal zeigt sich das gerade in kleinen Zahlen. Aber Gottes Kraft ist wirksam. Wir sind nicht angewiesen auf Hochglanz-Programme. Bei der Speisung der 5.000 hält Jesus das wenige Essen einfach hoch und dankt Gott dafür. Es steckt viel Kraft darin, wenn ich mich mit dem, was ich habe, Gott zur Verfügung stelle. Dann fängt seine Kraft an zu wirken. Das ist unsere Perspektive.
Was bedeutet das konkret?
Hartmann: Es kostet uns viel Kraft, wenn wir nur den Mangel beklagen. Irgendwann empfinden wir den Mangel stärker als er wirklich ist und sehen nur noch die Defizite. Es ist hilfreicher, auf das zu achten, was uns stärkt. Jesus hat das Wenige einbezogen, dann hat er auf Gott geschaut und gewartet, dass es sich füllt und die Menschen sättigt. Wir erleben immer wieder, dass dies in Gemeinden geschieht, auch wenn es das nicht in die Schlagzeilen schafft.
Viele Kirchen müssen mit weniger Geld zurechtkommen. Wie schlimm ist es für sie, dass immer nur nach dem Geld geschaut wird?
Hartmann: Wir nehmen den damit verbundenen Schmerz wahr und bringen eine andere, eine hoffnungsvolle Perspektive ein:Wenn sich kirchliche Gremien auf Gottes Gegenwart einlassen, entsteht oft eine Energie, die zu guten Lösungen führt.
Können Sie konkrete oder gelungene Beispiele nennen?
Knieling: Eine Gemeinde musste genügend Kandidaten für den Kirchenvorstand finden. Auf der Gruppe lastete ein enormer Druck. Am Ende des Tages hatten sie die Gelassenheit, mit den Menschen zu arbeiten, die da sind und nicht die vorhandene Norm erreichen zu müssen. Sie konnten wieder neu vertrauen, dass das reicht.
Wie können Gemeinden ermöglichen, dass Ehrenamtliche ihre Potenziale entfalten?
Hartmann: Ehrenamtliche brauchen ein Gefühl für den Mehrwert. Wenn ich mit Gott als Kraftquelle verbunden bin, spüre ich, dass mich das nährt und stärkt, was ich hier tue. Als kirchliche Gruppen haben wir die spirituelle Dimension. Das heißt, dass wir Gott in alles einbeziehen können. Wenn das nicht geschieht, müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen ausbrennen oder das Interesse verlieren. Gott gibt uns Kraft für den Alltag und lässt mich auch manche Durststrecken durchhalten. Der Schlüssel ist, Augen und Herzen offen zu halten, wo sich Gott uns zuwenden will. Das geschieht oft auch durch Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Das gilt übrigens nicht nur für Ehrenamtliche.
Hat es sich denn die Kirche in ihrer eigenen Blase zu bequem gemacht?
Hartmann: Ich denke nicht. Ich kenne sehr viele Menschen, die versuchen, anschlussfähig zu sein. Die tragen sehr viele Anliegen der Gesellschaft in ihren Herzen und setzen sich für den Zusammenhalt in ihrem Stadtteil oder in ihrer Gemeinde ein. Sie organisieren Veranstaltungen, um die Demokratie und das Miteinander zu stärken. Wir haben in unserem Buch auch die Zahlen aufgeführt, wer sich da alles engagiert. Wenn es dieses Engagement nicht gäbe, würde unserem Land viel Gutes fehlen.
Knieling: Es ist wie in dem biblischen Gleichnis. Manches ist noch im Boden verborgen und wird erst noch aufwachsen. Und es gehört zur Natur der kirchlichen Arbeit, dass manches gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist: In der Seelsorge, im vertraulichen Gespräch. Außerdem geschieht viel Gutes im kleinen Kreis und ist wirksam und wichtig für das gesellschaftliche Miteinander, aber erzeugt eben keine Schlagzeile.
Hartmann: Es ist ja nicht so, dass sich nur die Kirchen auf eine neue Zeit einstellen müssen. Überall fehlen Menschen und wir müssen schauen, wie wir mit Erschöpfung und Überforderung klarkommen. Die Probleme werden immer komplexer. Wir schauen nach Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir arbeiten ja auch mit Führungskräften aus Sozialunternehmen und anderen gesellschaftlichen Feldern und überall gilt: Ein gutes Miteinander ist entscheidend, um gute Lösungen zu entwickeln. Das braucht bestimmte Bedingungen. Die haben wir im Buch beschrieben.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus ihren Beratungsprozessen?
Knieling: Das Gute liegt so nah, manchmal braucht es nur einen besonderen Raum. Ich staune immer, mit wie wenig Mitteln ein Vertrauensraum entsteht und Führungskräfte auch bei heiklen Themen beginnen, einander zu vertrauen. Dann ist der Mut vorhanden, selbst schwierige Themen anzusprechen. Wenn Probleme benannt werden, werden sie auch kleiner. Deswegen begleiten wir solche Prozesse gerne. Damit das gelingt, muss man sich nur auf ein paar einfache Regeln einlassen.
Hartmann: Wir sind leider oft zu wenig in der Haltung des Empfangens unterwegs. Wir wollen steuern und kontrollieren und die Dinge „im Griff haben“. Das ist in manchen Situationen richtig und notwendig. In anderen Situationen hilft es aber nicht weiter und sorgt nur für Frust. Dort ist es wertvoller, wenn wir unsere Hände öffnen und uns von Gott beschenken lassen. Menschen, die das erfahren, werden barmherziger und gelassener, weil sie merken, dass es nicht nur auf sie ankommt. Das strahlt aus in den sozialen Kontext und sorgt für neue Überraschungsmomente.
Welche kleinen Regeln meinen Sie?
Knieling: Es geht um Vertraulichkeit, gegenseitiges Zuhören und darum auf schnelle Urteile zu verzichten. Vielleicht könnte mein Gegenüber ja recht haben mit seiner oder ihrer anderen Sicht. Jeder bringt etwas für ein gutes Miteinander ein. Wenn Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen sich darüber austauschen, was ihnen im Herzen wichtig ist, dann entsteht eine Verbundenheit, die Vielstimmigkeit ermöglicht. Das schafft Vertrauen.
Hartmann: Wichtig ist auch, zwischendurch innezuhalten und still zu sein. Wir „verdauen“ das, was gerade diskutiert wurde. Wir richten uns wieder neu auf Gott aus und beziehen ihn bewusst mit ein. Dann kommen ganz neue Gedanken in mein Herz. Beim Reden und Diskutieren übersehen wir leicht, was Gottes Geist in einem wachruft, wenn er wirkt.
Knieling: Wenn z.B. der Gebäudebestand auf der Tagesordnung steht,fragen wir die Teilnehmer danach, was eigentlich ihre Sehnsucht im Blick auf das Gemeindeleben in diesen Räumen ist. Auf der Basis dieser Ergebnisse können sie dann klarer entscheiden, ob und welche Gebäude verkauft werden. Oder welche anderen Perspektiven möglich werden könnten. Es bleibt oft eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung, aber die Menschen verstehen ihre unterschiedlichen Positionen besser und gehen tatsächlich mit mehr Zuversicht in die Zukunft.
Stellen Sie Unterschiede fest zwischen Landeskirchen und Freikirchen?
Hartmann: Oft nur in Nuancen. Viel häufiger spielt eine Rolle, ob es sich um eine ländliche oder städtische Gemeinde handelt oder um deren Größe. Ich habe früher gedacht, die Freikirchen sind selbstverständlicher im Hören auf Gott im Prozess unterwegs. Aber in unserer Arbeit mit den verschiedensten Kirchen im deutschsprachigen Raum hat sich gezeigt: das ist oft gar nicht so ausdrücklich der Fall. Auch in Freikirchen sind die Verantwortlichen oft unsicher, wie sie Gott in ihre Gremienarbeit integrieren, ohne zu manipulieren oder zu vereinnahmen.
Wo liegen in Zukunft die größten Chancen für Kirche trotz ihres Mangels?
Knieling: Indem sie darauf angewiesen ist, was sich schenkt. Wir sind selbst oft überfragt, was uns die Zukunft bringt. Das kann uns dafür öffnen, dass Dinge passieren, die uns überraschen. Das ist die Chance, dass wir darin auch Gott erleben, vielleicht wie noch nie in der Geschichte. Der Mangel zwingt uns, ein bisschen tiefer zu schauen. Ich erinnere mich an einen Ausschuss aus dem missionarischen Bereich. Da fragte mich jemand: „Waren wir in den 80er Jahren schon missionarisch oder hatten wir nur Geld?“ Bildlich gesprochen würde ich sagen: Wo liegt der Samen für das Reich Gottes schon im Boden, aber in meiner Gemeindevorstellung ist das noch nicht im Blick? Wo könnten wir noch Gottes Wirksamkeit entdecken, wo wir sie bisher noch nicht im Blick hatten?
Wenn Sie drei Wünsche für die Kirche freihätten, welche wären das?
Hartmann: Ich wünsche der Kirche mehr Offenheit für Gott.
Knieling: Ich wünsche mir, dass sie ihre Sinne dafür schärft, wie Gott gegenwärtig wirkt.
Hartmann: Dass die Einzelnen Gott nicht nur im stillen Kämmerlein suchen, sondern auch gemeinsam im Tagesgeschäft.
Knieling: Eine Gemeinde hat das einmal so erlebt. Sie haben gemerkt, dass sie sich jetzt einander ihren Glauben glauben. Das war die entscheidende Wende, dass nicht die einen als die Frommen und die anderen als die weniger Frommen einsortiert wurden, sondern dass sie sich einander ihre unterschiedliche Art zu glauben geglaubt haben, und alle auf den dreieinigen Gott bezogen sind.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hartmann, Isabel, Knieling, Reiner, Hoffnung. Zukunft. Kirche? Der Sehnsucht auf der Spur. Eine Vision für unser Miteinander, Neukirchener Verlag, 176 Seiten, ISBN: 9783761570029, 18 Euro.
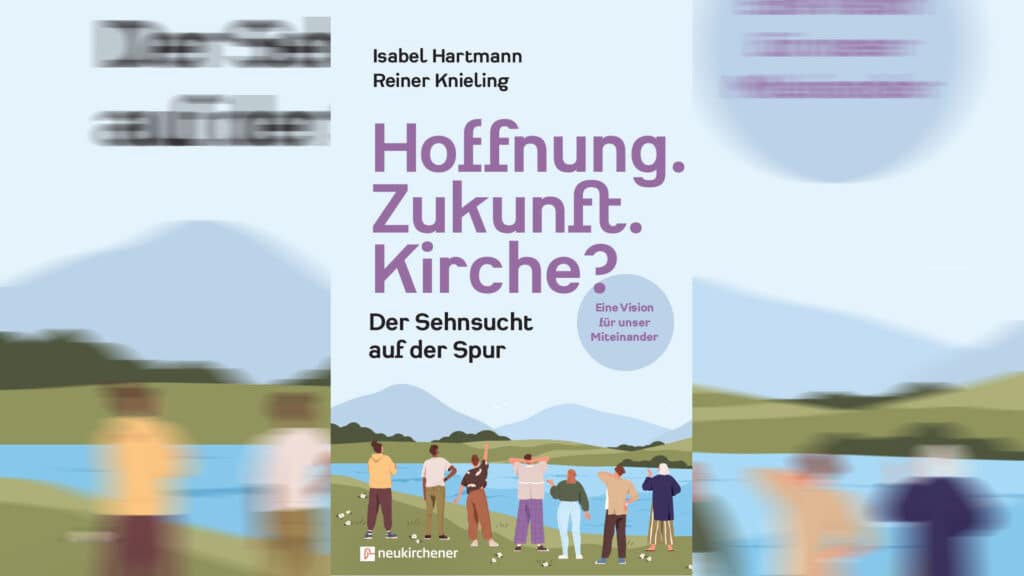
Pfarrerin Isabel Hartmann hat als Gemeindepfarrerin und Cityseelsorgerin gearbeitet und ist geistliche Begleiterin. Prof. Dr. Reiner Knieling hat lange in der theologischen Ausbildung gearbeitet: An der „Evangelistenschule Johanneum“ und an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Seit 2012 arbeiten beide zusammen und fördern seit dieser Zeit Menschen und Organisationen auf dem Weg, ihr berufliches Knowhow mit ihrer spirituellen Ausrichtung zu verbinden. 2022 haben sie Syntheo gegründet. Mit dem Institut für Zukunftskultur wollen sie einen nachhaltigen Kulturwandel zu mehr Vertrauen, Dialog und Zuversicht unterstützen, indem sie Leitungsgremien und Führungskräfte in Kirchen, Gemeinden und (Sozial-)Unternehmen in Prozessen begleiten.


